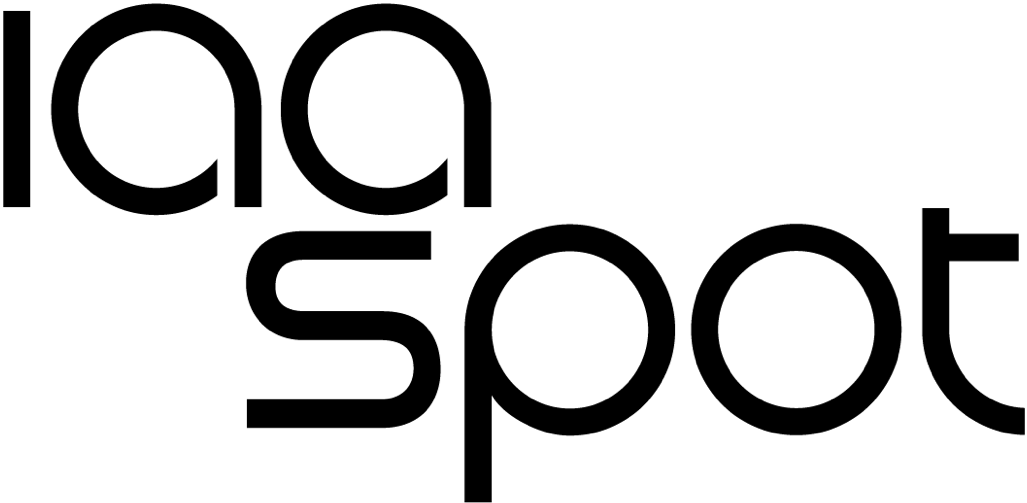Die Tankstelle steht vor einem radikalen Wandel. Neue Geschäftsmodelle, Elektromobilität, digitale Services und politische Vorgaben verändern die Branche tiefgreifend. Was bleibt vom klassischen Sprithändler – und was kommt?

Was früher nach Benzin roch, soll künftig nach Kaffee duften. Statt Straßenkarten soll es WLAN geben, statt Mineralöl nachhaltige Energie. Schon heute ist der Kraftstoffverkauf nur noch Nebengeschäft. Laut der kürzlich veröffentlichten Studie „Die Zukunft der Tankstelle“ des Beratungsunternehmens BearingPoint machen Shops, Convenience-Produkte und Dienstleistungen wie Autowäsche je nach Standort inzwischen bis zur Hälfte des Gesamtumsatzes aus – und das bei deutlich höheren Margen als im Kraftstoffverkauf.
Doch so richtig Brummen die Geschäfte zuletzt nicht mehr. Die Branche steht unter Druck: Sinkende Absatzmengen, steigende Betriebskosten, neue Mobilitätsformen und regulatorische Eingriffe wie die geplante Ladesäulenpflicht ab 2028 für größere Tankstellenketten zwingen zum Umdenken. Die Mineralölunternehmen müssen die Tankstelle völlig neu denken- und haben damit bereits begonnen. Aral etwa testete in Berlin bereits sogenannte „Mobility Hubs“ mit Hochleistungs-Ladesäulen und Lounge-Angeboten. Die Kooperation mit dem Lebensmitteleinzelhändler Rewe To Go sollte Convenience neu definieren. Gleichzeitig will der Mineralölkonzern über die „meinAral“-App die Digitalisierung und Kundenbindung vorantreiben. Shell geht ebenfalls bereits den Weg zum Anbieter von Mobilitätsplattformen. Neben klassischer Zapftechnik und E-Ladesäulen investiert der Konzern in Wasserstofflösungen und digitale Ökosysteme rund um die Shell-App. Den Kunden nicht nur beim Tanken begleiten, sondern auf jeder Etappe seiner Mobilität, lautet das Motto.
Der Druck auf die Tankstellen kommt nicht nur vom Markt, sondern auch aus der Politik. Ab 2035 dürfen in der EU nach aktuellem Stand keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden, ab 2028 sollen größere Betreiber an jeder Tankstelle mindestens eine Schnellladesäule installieren. Und schon heute sinkt der Absatz von Kraftstoffen. Wurden 2017 an deutschen Zapfsäulen noch über 57 Milliarden Liter getankt, waren es 2024 rund 51 Milliarden Liter. Vor allem die Diesel-Nachfrage ist eingebrochen – ein Trend, der sich angesichts der seit dem Abgasskandal schwindenden Neuzulassungszahlen von Diesel-Pkw noch beschleunigen dürfte. Da die Zahl der Tankstellen seit Jahren relativ stabil bei rund 14.000 liegt, sind der Spritdurchsatz pro Betrieb.
Gerade Dienstwagenflotten rüsten zunehmend auf E-Antrieb um. Damit sie weiterhin an der Tankstelle vorfahren, haben viele größere Betriebe mittlerweile auch Fahrstrom im Angebot. Die E-Mobilitätsprovider der Mineralölkonzerne – etwa Aral Pulse und Shell Recharge – zählen mittlerweile zu den größten Ladesäulenbetreibern in Deutschland. Trotzdem regt sich bei den Tankstellen Widerstand gegen die vorgesehene Ladesäulenpflicht. Man stoße an bauliche Grenzen, heißt eines der Argumente. Der Branchenverband en2x nennt die Ladesäulenpflicht „Symbolpolitik“ und warnt vor Fehlinvestitionen an falschen Standorten
Antworten auf die sich immer stärker abzeichnenden Entwicklungen braucht die Branche trotzdem. Die Tankstellen-Studie von BearingPoint rechnet bis 2035 mit tiefgreifenden Modifikationen – die Tankstelle wird zum Mobilitäts-Hub. Schnellladen, Integration ins Stromnetz und ein durch Digitalisierung geprägtes Kundenerlebnis heißen die Herausforderungen. Gastronomie, Paketshops und ein Shop mit Bio-Waren könnten für neue Besuchsanlässe sorgen. Auch eine Einbindung als Haltestellen für alternative Mobilitätsangebot könnten die Kundenfrequenz hochhalten. Im Zuge des Wandels rechnet die Studie auch mit einer neuen Betreiberstruktur: Die großen Mineralölkonzerne ziehen sich zurück, Lebensmittelhandel, Energieunternehmen und Mittelständler übernehmen.
Abgeschlossen ist der Wandel der Studie zufolge gegen Ende des kommenden Jahrzehnts. 2040 laden Fahrzeuge dann selbstständig, Tankstellen müssen stark ins Energienetz eingebunden sein und neue Geschäftsmodelle rund um Laden und KI-gestützte Fahrzeugwartung entstehen. Einen besonders hohen Veränderungsdruck erwarten die Experten in städtischen Regionen. Mit Flächenknappheit und hohen Mieten, strengen städtebaulichen Vorgaben sind die Herausforderungen dort besonders groß. Gleichzeitig bieten Städte aber auch Chancen: hohe Frequenz, digitale Infrastruktur und Innovationsbereitschaft sind vorhanden.
Auf dem Land wird der Wandel weniger disruptiv ausfallen, aber ebenfalls tiefgreifend: Die Herausforderungen dort sind sinkende Fahrleistung und Frequenz, hohe Verbreitung von Heimladen und weniger wirtschaftliche Relevanz klassischer Tankstellen. Eine lokale Verankerung durch Einzelhandel und technische Dienstleistungen für die Landwirtschaft könnte die Chancen einzelner Betriebe erhöhen.
Ob die Zeithorizonte nun exakt stimmen oder nicht: Die Tankstelle der Zukunft ist kein Ort mehr, an dem man nur tankt. Sie wird zum Energie-Marktplatz, Mini-Supermarkt, Ladepunkt, Logistikzentrum, Digital-Hub – oder schließt. Entscheidend ist die Anpassungsfähigkeit. Es geht nicht darum, ob sich Tankstellen verändern – sondern wie radikal, wie schnell und wie nachhaltig.